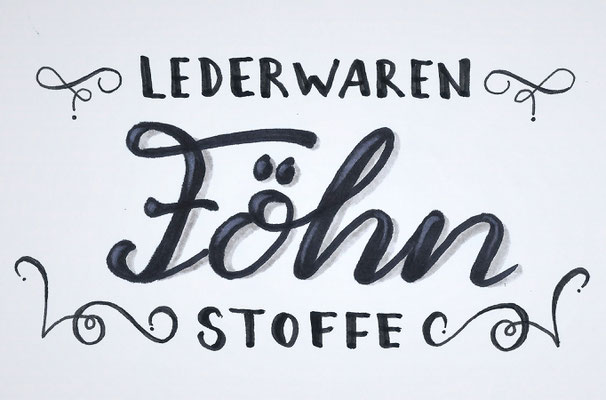Die Schwyzer Fasnachts Figuren
Die Entwicklung der Fasnachts-Gwändli
Heute wie früher wird eine klare Unterscheidung von Originalgewändern und anderen Fasnachtskostümen vorgenommen. Hier geht es um jene Figuren, welche in der Rott anzutreffen waren oder sind.
Zu den Originalgewändern zählen dr Blätz, dr alt Herr, s'Hudi, dr Zigüner, s'Bajazzomäitli und ds Domino.
Das Wort «original» aus dem Lateinischen und leitet sich von «orgio» ab, was „Ursprung“,„Quelle“ oder “echt” bedeutet.
Diese sechs Figuren kennt das Volk schon seit langer Zeit und sie haben sich in ihrer typischen Eigenart kaum gravierend verändert. Heute besteht die erfreuliche Tendenz, dass sich die Rotten der "Schwyzer Nüssler" fast ausnahmslos aus Originalfiguren zusammensetzen.
Die "Güdelmontags Rott" weist ebenfalls zu einem Grossteil die Originalkostüme auf.
Glücklicherweise ist es in Mode gekommen, auch schon die Allerkleinsten original zu bekleiden.
Die Tendenz zum Originalen, zum Althergebrachten und Überlieferten lebt erneut auf.
In Zeiten, als die Weltkriege auch die Fasnacht durch Regierungs- und Bezirksratsverbote beeinträchtigten, sah man nur wenige Originale. Das Geld für die Herstellung und die Miete fehlte. In diesen Zeiten und auch später noch, sah man neben Figuren, welche in allen Varianten auftauchten auch solche, welche man immer wieder und mehrere davon zu sehen bekam. Darunter fällt insbesondere der gefürchige Wilde Mann, der verachtete Teufel, der originelle Bauer oder Viehhändler, oder auch etwa der Landsturmsoldat. Weiter traf man das "benuggelte" (beschnullerte) "Titti" mit dem Kissen an und nicht zu vergessen der Bajass mit dem Spitzhut. Der Bauer kam äusserst viel vor, so dass man ihn auch schon fast zu den Originalfiguren hätte zählen können. Immer mehr wichen dann diese Figuren den Originalkostümen und sind so heute recht selten anzutreffen.

Ursprünge der Fasnacht
Über die Fasnacht allgemein und deren Ursprünge ist viel geschrieben worden. Geschichtliche Dokumente sind leider sehr wenige vorhanden. Spezifische Unterlagen für unsere Schwyzer Fasnacht sind äusserst spärlich. Zu einem grossen Teil sind es denn auch Vermutungen, die niedergeschrieben wurden. Folgende Ansicht wird häufig vertreten: Unsere Fasnachtsbräuche seien ein Überbleibsel von kultischen Tänzen und Sitten der Heiden. Sie wollten die bösen Geister und Dämonen beschwören und sie vertreiben.
Dr. Werner Röllin (aus Wollerau) forscht für unsere Schwyzer Fasnachtsbräuche und sagt, dass unsere Fasnacht nachweisbar auf das letzte oder vorletzte Jahrhundert zurückgehe. Aus dem 17. Jahrhundert seien erste Hinweise auf ein Fasnachtstreiben vorhanden. Unsere Gewänder stammen aus dem barocken Schauspiel und orientieren sich an italienischen Vorbildern, insbesondere an Arlecchino. Es seien also nicht mythologische Gedanken gewesen, als die Fasnacht entstand, sondern es gefiel den Leuten, die Figuren wurden importiert und verfeinert. Dies zwei Ansichten und die Uneinigkeit der Forschungen.
Es ist charakteristisch, dass in gewissen Regionen grosses Fasnachtstreiben herrscht (Innerschweiz, Ostschweiz, Basel, Luzern), in andern fast keines (Bern, Westschweiz). Nachweisbar sind die behördlichen Verbote, welche noch lange Zeit gegen die Fasnacht bestanden. Heute ist dem nicht mehr so, obwohl die Behörden noch die offiziellen Fasnachtstage festlegen.
Der Brauch Fasnacht
Wir dürfen die Fasnacht sicher als Brauch bezeichnen, wenn wir die Definition von P. Geiger betrachten:
"Da das Wesen des Volkes durch Gemeinschaft und Tradition bestimmt ist, lässt sich Brauch definieren als eine Art zu handeln, die durch Überlieferung in einer Gemeinschaft von Menschen als richtig oder verpflichtend empfunden wird.»
P. Geiger: Deutsches Volkstum in Sitte und Brauch, Berlin und Leipzig 1936, Seite 3
Typische Brauchelemente sind auch in der Schwyzer Fasnacht zu finden: Der Tanz, Spiele, Umzüge, Feuer, Lärm, Essen, Schenken, besondere Gestalten. So reiht sich die Fasnacht zu den anderen Bräuchen und wird wahrscheinlich noch lange Bestand haben.