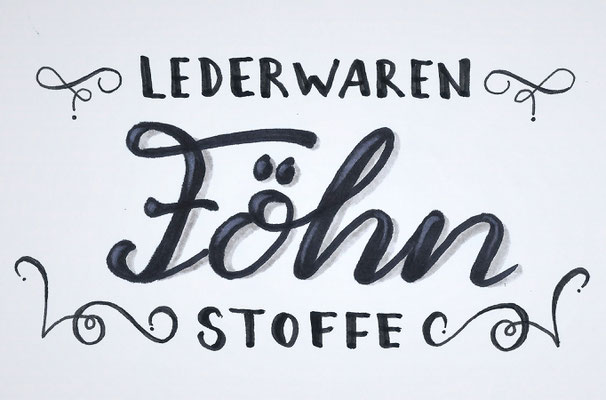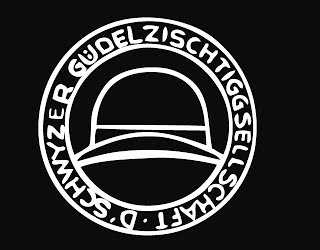

Die Geschichte der GDG
Der Güdeldienstag ist der Tag der Kinder, und an vielen Orten der Innerschweiz verläuft der Übergang zur Fastenzeit recht ruhig. Die Schwyzer freuen sich am Güdeldienstagabend an einem besonderen Anlass, der Blätzverbrennung. Die Leute sind sich gewöhnt, es gehört in Schwyz einfach zur Fasnacht, es ist zur Tradition geworden, wie man gerne sagt. Doch so alt ist dieser Brauch gar nicht, es waren 1977 genau 40 Jahre seither, als die Gesellschaft, welche heute diesen Brauch aufrechterhält, gegründet worden ist.
In den ersten Vereinsstatuten wurde in der Zweckbestimmung Folgendes erwähnt: "Aufrechterhaltung der Fasnachtsverbrennung, wie dies schon in den Jahren 1740 in Schwyz geschah".
Erstes Protokollbuch der Güdelzischig Gesellschaft, erste Statuten des Vereins.
Offenbar fanden früher schon Fasnachtsverbrennungen statt. Der Präsident der Gesellschaft erklärte, dass das Blätzverbrennen keine Kopie des "Böögverbrennens" sei. Man kann hier beipflichten, denn viel eher war es eine spontane Idee, nach der man den ersten Scheiterhaufen verbrannte, und sicher wollte man später mit dem Verbrennen unserer Hauptfasnachtsfigur symbolisch ein Zeichen für das Fasnachtsende setzen.
Ich will es aber trotzdem nicht unterlassen die Deutung des Fasnachtsverbrennens von einem Volkskundler als Ergänzung zu erwähnen. Dr. Erich Schabe schreibt:
In Schwyz wird am Abend des Fasnachtsdienstags der Blätz verbrannt. Diese und ähnliche Gestalten versinnbildlichen nicht allein die Fasnacht sondern im Grunde ihres Wesens viel mehr noch die winterlichen Schreck-Dämonen, die nun dem läuternden Feuer überantwortet werden läuternd, indem es morsch, faul Gewordenes austilgt, symbolisch damit dem Bösen zu Leibe rückt, zugleich aber auch aus der Asche heraus fruchtbaren Neubeginn in Aussicht stellt.
Wenig nur weiss man darüber, wann und in welcher Weise der Brauch des Fasnachtsverbrennens entstanden ist. Sein Ursprung verliert sich im Dunkel der Zeit, und es bleibt unklar, ob ursprünglich der Popanz, dessen Ende man herbeisehnte, Anlass zur Feuerzeremonie gab, oder ob umgekehrt die Flamme als auf den Frühling deutende Lichterscheinung das Grundelement bildete.
Erich Schwabe: Schweizer Volksbräuche, Silva Verlag Zürich 1969 Seite 60
Wie schon angetönt, glaube ich, dass es andere Motive waren, welche in Schwyz das Blätzverbrennen begründen. Die Gründung der GDG hat einen Ansatz im Jahre 1935, an einem Güdeldienstag, als einige Fasnächtler im Ratskeller in fröhlicher Stimmung beisammensassen und berieten, was sie noch lustiges treiben könnten. Franz Krienbühl (Wirt) holte die nachfolgend abgebildete Fahne hervor und versprach sie ihnen, wenn sie einen Verein gründen.
Diese Fahne stammte aus dem Jahre 1905. Sie wurde von einer losen Gruppe von Fasnächtlern hergestellt, welche am Güdeldienstag mit der Fahne als Standarte allerlei Unk und Unfug trieben, ehe die Fasnacht ihr Ende nahm. Durch den Krieg wurde die Tätigkeit dieser losen Gruppe unterbunden, und die Sache verlief im Sand. Diese Fahne ist heute noch stolzes Symbol der Gesellschaft.
Im Jahre 1936, am Güdeldienstag, trafen sich fast die gleichen Fasnächtler wiederum im Ratskeller. Mit dem Fahnen zog eine übermütige Schar (ca. ein Dutzend) nach Seewen und trieb dort allerlei Spässe, bis sie wieder nach Schwyz gejagt wurden. Dort schichteten sie einen grossen Reisighaufen auf und entzündeten ihm um 20.00 Uhr. Dieses erste Feuer kann wohl als Anlass zur Gründung eines Vereins angesehen werden. Am 19. Januar 1937 war es dann soweit. Die Gründungsversammlung im Pöstli legte fest, dass sie den alten Brauch, die Fasnacht zu verbrennen, wiederaufleben lassen wollen. Unter Präsident Franz Krienbühl, Ratskeller, fand sich ein Vorstand zusammen, der schon im nächsten Jahr die Statuten zur Genehmigung vorlegte. Da der Güdeldienstag nicht offizieller Fasnachtstag war, gab es Schwierigkeiten mit den Bezirksbehörden, denn das Maskengehen an diesem Tag war verboten. 1937 wurde erstmals der Blätz verbrannt. 40 Masken und 300 Zuschauer beteiligten sich. Aber auch einige eiskalte "Bsetzi" verjagte es, worauf der Bezirksrat für die kommenden Jahre eine Sandschicht anordnete. 1938 entzündete man erstmals auch vor Mitternacht noch ein kleines Feuerehen um mit der Verbrennung der Garben symbolisch Abschied von der schönen Zeit zu nehmen. Gütsch-Kari, der leidenschaftliche Fasnächtler, konnte das Weinen nicht zurückhalten.
Die Kriegsjahre bedeuteten einen Einschnitt in das fasnächtliche Treiben und teilweise musste auf den Scheiterhaufen verzichtet werden (Rationierung des Holzes). Im Jahre 1946 ging es aber erneut los und erstmals wurde der Abend mit einem Feuerwerk begangen und etliche Maskeraden nahmen am kleinen Einzug teil. Die ursprünglich noch primitive und kleine Blätz Figur, die während vielen Jahren im Hof der Apotheke St. Martin bei Gottlieb Triner (Gründungsmitglied) gebastelt, gestopft und gemalt wurde, nahm immer grössere Formen an und wurde kräftig mit Feuerwerkskörpern und Petarden ausgestattet. So schrieb denn ein Protokollführer im Protokollbuch: "Der schönste Moment war, als der Grind in tausend Stücke flog, ein Zeichen, dass die Fasnacht Tod ist und bleibe bis sie wieder aufblühe und erwache im nächsten Jahre".
Erstes Protokollbuch der Güdelzischig Gesellschaft
So entwickelte sich der Brauch immer mehr und erfreut sich heute noch grosser Beliebtheit. Der Name der Gesellschaft hat sich aus der Geschichte der Veranstaltungen ergeben, als Symbol wurde der Googs (englische Melone) gewählt.
Die heutige Gestaltung des Güdeldienstag durch die GDG
Natürlich müssen allerlei Vorbereitungen für diesen Tag getroffen werden. Die Figur wird jeweils von den Kitgliedern selbst hergestellt. Den Stoff schneidet Otto Koller, Sattlerei, und näht ihn auch zusammen. Ca. 14 Tage vorher wird die Figur mit Schablonen gespritzt (blaue und rote Rauten). Dies geschieht in den Hallen des Baugeschäftes Bolfing oder der Eisenhandlung Karl Weber in Seewen. Dann wird er mit Stroh gestopft, was sehr anstrengend ist. Erst am Güdeldienstag wird er von der Feuerwerksfirma Hamberger in Oberriet (am Brienzer See) mit Petarden und Feuerwerkskörpern (Feuer- knall- und Rauchkörper) gestopft. Das übrige Feuerwerk wird auch von dieser Firma geliefert. Natürlich ist auf dem Schwyzer Hauptplatz die Auswahl vom Feuerwerk eingeschränkt, da der Platz umgeben ist von Häusern, die recht nahestehen. Hier braucht es genaue feuerpolizeiliche Abklärungen. Alljährlich wird auch eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, um gegen auftretende Schäden aufkommen zu können. Bisher blieb man vor grössern Unfällen verschont.
Am Güdeldienstagvormittag versammeln sich die "Güdelzischtiger" jeweils zu einem Aperitif im Stammlokal (Pöstli). Hier befindet sich auch die nachfolgend abgebildete Stammtischfigur, eine originalgetreue Nachbildung des Scheiterhaufens mit dem Blätz, welche von den Mitgliedern selber hergestellt wurde.
Am Nachmittag gehen sie als geschlossene Gruppe, mit der englischen Melone (Googs) auf die Wirtschaftstour. Auf dem Platz wird auf der Sandfläche das Gerüst mit dem Blätz aufgestellt und das Brennholz herangetragen. Die Feuerwehr richtet sich ein und die Feuerwerke werden aufgestellt. Dann folgt ein gemeinsames Buseccaessen und um 20.00 Uhr beginnt der offizielle Teil.
Beim Hotel drei Königen versammeln sich die Maskeraden und ziehen über die Schulgasse, in Begleitung zweier Tambouren, auf den Hauptplatz. Angeführt werden sie vom Rottfahrer (Präsident der GDG), welcher den Besen mitträgt (Caspar Pfyl führte dies ein). Viele Maskeraden nehmen die letzte Gelegenheit noch einmal wahr. Man begegnet neben Originalgewändern vielen originellen und amüsanten Verkleidungen. Jetzt wird bei Fackelschein nochmals ausgiebig genüsselt. Wenn die Tambouren dazwischen verstummen, geht das Geheul der Maskeraden los. Dann folgen in Etappen die Feuerwerke, welche es nochmals hell werden lassen auf dem Hauptplatz. Viele Zuschauer stehen hinter den Abschrankungen und heulen vielleicht auch innerlich mit. So wechseln sich Narrentanz, Heulen und Feuerwerk ab, bis der Scheiterhaufen des Blätzes entzündet wird, und die Flammen und Knallkörper der typischsten Schwyzer Fasnachtsfigur ein Ende setzen. Das Kässlein der GDG wird noch herumgegeben, ehe die Rott noch auf eine kleine Wirtschaftstour (Schäfli - Sternen - Storchen - Ratskeller) zieht. Die Maskeraden unterhalten die Leute in den Wirtschaften noch ein letztes Mal. Die Klosterchilbi Güdeldienstag Abendrott ist eine lose Gruppierung, welche jeweils auch mitmacht und vor allem die Wirtschaften im Hinterdorf besucht.
Um 23.30 Uhr treffen sich die Maskeraden und eine ansehnliche Schar Leute um die traurigste halbe Stunde bei den Klängen des Narrentanzes zu verbringen. Nochmals wird tüchtig genüsselt und ein gefülltes Stoffstück des Blätzes angezündet. Um 24.00 Uhr läutet die grösste Glocke der St. Martinskirche die Fastenzeit ein. Die Trommeln verstummen und heulend werden die Masken verbrannt. Für den Schwyzer hat eine schöne Zeit ein Ende genommen. Jetzt beginnt das Warten auf die nächste Fasnacht im kommenden Jahr!